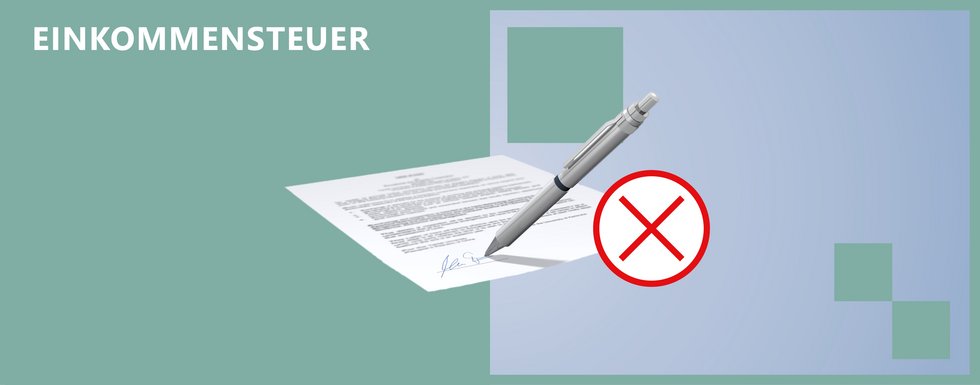Die steuerliche Anerkennung von Betriebsausgaben setzt voraus, dass diese betrieblich veranlasst und nachvollziehbar dokumentiert sind. Besonders kritisch wird es, wenn Zahlungen zwischen nahestehenden Unternehmen oder Personen erfolgen. Hier verlangt die Rechtsprechung regelmäßig einen strengen Fremdvergleich: Würde ein fremder Dritter unter denselben Umständen ebenso gehandelt haben?
Doch welche Rolle spielt die Form? Reicht eine mündliche Vereinbarung – oder braucht es zwingend schriftliche Verträge, um Betriebsausgaben steuerlich anzuerkennen? Mit dieser Frage musste sich jüngst das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) befassen.
Fall
Eine Unternehmensgruppe im internationalen Holzhandel bestand aus mehreren Gesellschaften. Die Mutter-GmbH war Alleingesellschafterin zweier GmbH & Co. KGs:
- Die Chef-KG war die Strategieträgerin und übernahm zentrale Aufgaben wie Einkauf, Planung und Errichtung von Sägewerken.
- Die Lohnjob-KG betrieb ein Sägewerk und arbeitete als Lohnfertigerin für die Chef-KG.
Im Jahr 2005 errichtete die Chef-KG für die Lohnjob-KG ein Sägewerk. Schriftliche Vereinbarungen über die Abwicklung und Schadensregulierung gab es nicht. Durch Planungsfehler entstanden Mehrkosten in Höhe von rund 4,1 Mio. Euro. Erst 2009 kam es zu einer mündlichen Einigung: Die Chef-KG verpflichtete sich, etwa 4 Mio. Euro Schadensersatz an die Lohnjob-KG zu zahlen, um deren Verluste auszugleichen.
Das Finanzamt verweigerte den Betriebsausgabenabzug bei der Chef-KG. Begründung: Zwischen nahestehenden Personen müsse es klare, schriftliche Vereinbarungen geben, die dem Fremdvergleich standhalten. Ohne Schriftform könne die Zahlung steuerlich nicht anerkannt werden. Das Finanzgericht Thüringen bestätigte diese Sichtweise und wies die Klage ab
Die Entscheidung des BVerfG
Das BVerfG hob die Entscheidung auf. Begründung: Die Versagung des Betriebsausgabenabzugs allein wegen fehlender Schriftform verstößt gegen Art. 3 Abs. 1 GG (Willkürverbot).
Der Fremdvergleich verlangt eine inhaltliche Prüfung, ob das Geschäft so auch unter fremden Dritten abgeschlossen worden wäre.
Eine zwingende Schriftform schreibt das Gesetz nicht vor. Auch mündliche oder konkludente Vereinbarungen können steuerlich anzuerkennen sein, wenn sie tatsächlich umgesetzt wurden.
Eine pauschale Ablehnung ohne Gesamtwürdigung ist nicht mit dem Gleichheitsgrundsatz vereinbar.
Bedeutung für die Praxis
Der Beschluss hat große Bedeutung, vor allem für Personengesellschaften und Einzelunternehmer:
Fehlende Schriftform allein reicht nicht aus – Betriebsausgaben dürfen nicht mehr allein deshalb gestrichen werden.
Die Gesamtwürdigung ist entscheidend: Steuerlich relevant ist, ob die Absprachen wirtschaftlich nachvollziehbar sind und tatsächlich gelebt wurden.
Bei Kapitalgesellschaften gelten wohl weiterhin die strengen Anforderungen zur formellen verdeckten Gewinnausschüttung.
Fazit
Das BVerfG stärkt mit diesem Beschluss die Rechte der Steuerpflichtigen. Reine Formmängel dürfen nicht mehr zur Versagung von Betriebsausgaben führen, solange die Vereinbarungen real umgesetzt wurden. Damit erhalten Unternehmen in Betriebsprüfungen mehr Rechtssicherheit.
Fundstelle
Beschluss des BVerfG, 27.05.2025, 2 BvR 172/24, DStR 2025, 1569